3 neue short stories von Rüdiger Saß
Der Tag, als Josef Stalin starb
Ein Sonntagsspaziergang
Kleines Philisterium
Der Tag, als Josef Stalin starb
An dem Tag, als Stalin starb, war ich minus dreizehn Jahre alt und trieb mich im Land der Frikadellen herum. Meine bereits voll ausgereiften Hämorrhoiden sagten mir, dass an diesem frühen Frühlingstag nicht der Genosse Diktator seine schwarze Seele auf den Teppich seiner Datscha gekackt hat, sondern einer seiner Doppelgänger. Das Original hockte hinterm Haus auf der Terrasse und zeichnete wie jeden Morgen Todeslisten ab. Es bildete sich ein, derlei Tätigkeit fördere Verdauung und Immunsystem. Wie auch immer. Stalin musste über seinen Geschäften eingenickt sein, denn als er erwachte, wusste alle Welt über seinen Tod Bescheid. Alle wussten es, nur nicht er. Er erschoss zuerst seinen Diener, den Überbringer der schlechten Nachricht mit seinem besten, seinem einzigen Freund, einem Revolver, dann dachte er nach, dachte lange nach und tauchte schließlich unter. Er hatte seine Gründe …
 Unter seinem Mädchennamen Dschugaschwili schlug er sich in seine Heimat Georgien durch, um in Tiflis ein neues Leben zu beginnen. Er fristete ein kümmerliches Dasein als Untersetzer, als Besenwart und frustrierter Frührentner, bevor er sich nach langem Ringen und kurzen Prozessen zum Kantinenkönig eines illegalen Priesterseminars putschte. Eines Tages jedoch - es nahte die Stunde meiner Geburt - fegte mal wieder eine Säuberungswelle über die Sowjetunion hinweg, die alle Stalinisten erfassen sollte. Nun sahen fast alle damals, auch die Frauen, aus wie er, wie Stalin: mit buschigen Augenbrauen und buschigem Oberlippenbart. Über Nacht aber sahen alle aus wie Chrustschow, sein Nachfolger auf dem roten Thron im Kreml. Über Nacht verwandelten sich die Völker der Sowjetunion in Gartenzwerge mit Glatze und eingedrückter Nase. Stalin blieb keine Wahl als abermals unterzutauchen. Mit gezielten Schlägen in die Magengrube verabschiedete er sich aus dem Priesterseminar, dann trennte er sich unter Tränen von seinem Bart und floh auf dem Rücken eines Esels über die Mongolei nach China.
Unter seinem Mädchennamen Dschugaschwili schlug er sich in seine Heimat Georgien durch, um in Tiflis ein neues Leben zu beginnen. Er fristete ein kümmerliches Dasein als Untersetzer, als Besenwart und frustrierter Frührentner, bevor er sich nach langem Ringen und kurzen Prozessen zum Kantinenkönig eines illegalen Priesterseminars putschte. Eines Tages jedoch - es nahte die Stunde meiner Geburt - fegte mal wieder eine Säuberungswelle über die Sowjetunion hinweg, die alle Stalinisten erfassen sollte. Nun sahen fast alle damals, auch die Frauen, aus wie er, wie Stalin: mit buschigen Augenbrauen und buschigem Oberlippenbart. Über Nacht aber sahen alle aus wie Chrustschow, sein Nachfolger auf dem roten Thron im Kreml. Über Nacht verwandelten sich die Völker der Sowjetunion in Gartenzwerge mit Glatze und eingedrückter Nase. Stalin blieb keine Wahl als abermals unterzutauchen. Mit gezielten Schlägen in die Magengrube verabschiedete er sich aus dem Priesterseminar, dann trennte er sich unter Tränen von seinem Bart und floh auf dem Rücken eines Esels über die Mongolei nach China.
Mao empfing seinen Freund mit offenen Armen. Er tat ihm leid, da er daran dachte, dass es ihm ebenso ergehen könnte. Das Schicksal ist ein launisches Luder. Mao machte Stalin zu seinem Schatten, zu seinem Ohrenbläser.
So ließ es sich leben. Stalin setzte mit den Jahren Fett an, die Speckringe um seinen Bauch zogen immer weitere Kreise bis zu dem Tag, als Mao starb. Für Stalin hieß das, mal wieder das Weite zu suchen. Denn Maos Nachfolger hatten die Zeichen der Zeit erkannt und die Uhren Chinas auf Kapitalismus umgestellt. Doch wohin? Mittlerweile war selbst die Mutter der Revolution, die Sowjetunion aus dem Leim gegangen und in seine einzelnen Teile zerbrochen. Und so blieb nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, zwischen Kuba und Nord-Korea. Weil gerade kein Flieger nach Havanna zur Hand war, entschied sich Stalin für das geographisch und ideologisch nähere Pjöngjang. Aber zum ersten Mal in seinem Leben - und einige Jahre nach meinem Ableben - hatte er allen Grund, seine Entscheidung zu bereuen. Denn die Kim-Dynastie duldete keine Sonne neben sich. Stalin wurde kurz nach seiner Ankunft in einem Hotel verhaftet. In einem Schauprozess, wie er ihn lieben würde, wenn er nicht auf der Anklagebank gesessen hätte, wurde er zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt, in schweren Ketten, bei Wasser und Brot. Aber Stalin wäre nicht Stalin, wenn er nicht auch diese Situation gemeistert hätte. Es dauerte nicht lang, bis er die Herzen seiner Folterknechte erobert hatte, nicht lange, bis er selbst ein Folterknecht war. Und wenn er nicht gestorben ist, dann foltert er noch heute.
Ein Sonntagsspaziergang
Nicht die Zeit rast, sondern die Menschheit rast durch Raum und Zeit, mit dem Rollstuhl auf der Autobahn, mit der Stoppuhr auf dem Klo … Die Leute sind zu Arbeits- und Konsumrobotern verkommen. Und sie lassen es sich gefallen, sie lassen es sich als Freiheit, als ihren eigenen freien Willen verkaufen. Alle marschieren im Gleichschritt, alle außer Mutter Piepgas. Sie bestreicht Bäume mit Marmelade und beißt hinein. Derweil verlegen ihre Söhne Hector und Hurtig ihr Gebell vom Hof ins Haus. Ihre Stärken liegen im Kacken, Kleckern und Verschütten. Mutter Piepgas schleppt zwei linke Gehirnhälften mit sich herum; das hat Vor- und Nachteile: Fliegen vertreiben sie von den Marmeladenbäumen. Fliegenschwärme verfolgen sie, Schmeiß- und Sturzkampffliegen. Mutter Piepgas geht zum Gegenangriff über. Sie hetzt Hector und Hurtig, ihre Kampfkinder auf die Fliegen. Dann geht sie mit ihnen Gassi, mit den Kindern, nicht den Fliegen. Es grenzt an Meditation, an innerste Versenkung, wenn die Rangen an einem Baum, an einer Hausecke mit aller Kraft zu kacken versuchen und Mutter Piepgas mit gezücktem Plastikbeutel wartet, um die Haufen ihrer Liebsten aufzulesen. Vom Kirchturm gegenüber fällt aus großen Lautsprecherboxen Glockengeläut. Es grenzt an Selbstaufopferung, an Selbstüberwindung, wenn Pfarrer Unzucht von Gott und allen guten Geistern verlassen vor dem verregneten Portal auf Kundschaft wartet und wartet und weiß, dass auch heute niemand die frohe Botschaft hören will; niemand, der über den Tellerrand seines aufgeblasenen Ichs und seiner Lebenszeit hinausblicken will, außer vielleicht einer verirrten Göre oder eines verwirrten Rentners. Pfarrer Unzucht nimmt Mutter Piepgas aufs Korn, soweit das über die Straße hinweg möglich ist. Die Piepgas fühlt sich angezogen. Sie zieht ihre Kinder von Hausecke und Baum, sie zieht sie an der Leine zur Kirche, einem nüchternen Nachkriegsmodell, dessen Seitenschiff von einem Schild mit der Aufschrift „Zu Verkaufen“ in den Schatten gestellt wird.Nach verrichteten Dingen setzt Rumpffamilie Piepgas ihre Promenade fort. Es geht wie immer in Richtung Friedhof. Es geht über aufgerissene Straßen, entlang von Häusern, die sich hinter Baugerüsten verbergen, vorbei an Baggern, durch Baukranalleen und Baukranwäldern. Die Grabsteine nicken Mutter Piepgas wie alte Bekannte zu. Aber was heißt hier „Wie“ für jemand, der für sein Alter schon reichlich Federn hat lassen müssen, der bei lebendigem Leib verschimmelt, der sich wie die Piepgas auf halbem, sprich auf bestem Weg in die Ewigkeit befindet?
Auch heute fahndet die Familie vergeblich nach Vaters Grab. Wer weiß, vielleicht verfault er auf einem andern Acker? Mutter Piepgas nimmt ihre Kinder an die kurze Leine, da ihnen jemand den Weg zwischen den Grabreihen versperrt. Es ist der Gott, der Eisen wachsen ließ, ein Junkie alten Schlags: fahrig und nervös, abgemagert und mit fliehendem Blick, kurz: auf den Hund gekommen. Aus dem Wolkenteppich regnet es Musik, Kaufhausmelodien und eine wohlklingende Baritonstimme, die auf die Schnäppchen der Woche aufmerksam macht, auf ein All-Inclusive-Begräbnis mit Probeliegen und Blick aufs Meer ... Der Boden schwankt, er hebt und senkt sich, und es sprießen die Toten zwischen Stiefmütterchen, Buschwerk und Zypressen hervor: zuerst Arme und Beine, winkende Arme und strampelnde Beine, dann schälen sich vom Zahn der Zeit zernagte Gestalten aus der Erde: Zahn-, Nieren- und Urinfossilien, von einer Karriere als Jahrmarktsmumie beseelt. Mit altertümlichen Staubsaugern bewaffnet, beginnen die Toten, für Ordnung auf dem Friedhof zu sorgen. Typisch deutsch!
Mutter Piepgas erkennt ihren Gatten schon von weitem: an dem selbstgefälligen Wiegeschritt eines Zuvielfraßes mit einem Bewusstsein, das sich bereits zu Lebzeiten in Luft aufgelöst hatte. Sein ganzes Leben hatte er nichts als Scheiße im Schädel. Irgendwann gesellte sich ein Tumor hinzu, der zuerst die Scheiße und dann ihn auffraß. Für seine Frau war er nichts als ein Bakterienteppich mit Armen und Beinen, ein intellektueller Einzeller. Und dabei ist es geblieben. Denn wenn ein Krieg zu Ende geht, wütet er in den Köpfen weiter. Ohne Vorwarnung hetzt die Mutter ihre Köterkinder auf ihren Vater. Der Gott, der Eisen wachsen ließ, muss zusehen, wie sein Schützling zerfetzt wird. Der Junkie hat sein Pulver längst verschossen, er hat nur noch die Kraft, sich an Mutter Piepgas heranzupissen und sie um Kleingeld anzuhauen. „Wie wäre es mit einem Hauch von Sonntagsruhe?“, giftet die Piepgas und steuert auf den Kitsch- und Klischeeimbiss vor dem Friedhofstor zu. Balken-Horst, der Imbissionär, stellt sich schützend vor seine große, grüne Mülltonne. Er kennt seine Pappenheimer. Doch die haben es diesmal nicht auf ihn, auf Balken-Horst und seine große, grüne Mülltonne abgesehen. Noch nicht. Anstatt ihn also zu zerfleischen und durch den Kitsch- und Klischeewolf zu drehen, steigen sie in den Imbissfahrstuhl, einen Paternoster und sacken ab in den Keller der Geschichte. Die Piepgas entscheidet sich wie fast immer für Etage Neunzehnhundertneunzig. Das waren noch Zeiten! In Klarsichtfolie eingeschlagene Geschichte. Da war die Welt noch in Ordnung, oder genauer: wieder in Ordnung. Der real existierende Sozialismus und die bösen Kommunisten lagen in den letzten Zügen, und die Sonne der freien Marktwirtschaft ging nach langer, langer Zeit wieder über der ganzen, ungeteilten Erde auf. Es herrschte eine Aufbruchs- und Goldgräberstimmung. Ganze Kontinente wollten unterworfen, wollten wie Torten aufgeteilt, wie Minen ausgebeutet werden. Und Mutter Piepgas war jung und frisch und faltenfrei wie ein gestärktes und gebügeltes Tischtuch. Es war das Jahr ihrer größten sexuellen Erfolge, jenes Jahr, ehe sie auf ihr Verhängnis, auf den Vater ihrer Kinder stieß. Die ganze Welt lag ihr zu Füßen, die Hauptstraße des Lebens sprießte voller verlockender Abzweigungen, die ihr alle offenstanden. Sie brauchte sich nur zu entscheiden. Doch sie tat es nicht, sie wartete nur und wartete …
Nach dem Besuch im Imbiss gilt es zu verdauen, zu viele und zu große Brocken mussten geschluckt, mussten hinuntergewürgt werden. Da helfen weder Natron noch Zahnstocher. Beschleunigten Schrittes geht es an der vor sich hin dösenden Hanebücherei vorbei, einer rabenschwarzen Kriegsruine. Die Bücherei ist ein Magnet für Liebhaber ausgesuchter Strand- und Badewannenliteratur, Bücherbataillone voller Sprengsätze … Zurzeit hängt alles auf Halbmast, sogar Selbstmörder, Hinterhof- und Schrebergartenfahnen. Und selbst sämtliche Cocktailfähnchen in den Bars dieser Stadt lassen ihre Köpfe hängen. Das mag am Wetter liegen, den der Herbst mitzubringen die Frechheit hatte. Fingerhüte die neueste Herrenkopfbedeckung, der letzte Schrei, der allerletzte, wie die Piepgas hofft. Ein Vertreter des europäischen Rhinozeros, eine Kreuzung aus Elektroelefant und Popelhäher mit einer auffälligen Schwellung im Schritt macht Mutter Piepgas seine Aufwartung. Es regnet goldgelbe Handküsse und Komplimente, die ganze Bandbreite verbaler Luftverschmutzung. Die Piepgas zeigt dem Galan die kalte Schulter. Sie fühlt sich noch zu geschwächt vom Gottesdienst, als dass sie Lust verspürte, sich schon wieder hinter die nächste Hecke oder Ecke zu drücken. Hector und Hurtig knurren den Wegelagerer der Liebe aus dem Weg, ihn mitsamt seinem Erdbebengesicht und noch viele andere von Hormonen vor sich Hergetriebene. Madame bedauert zusehends, das Haus ohne Sprengstoffgürtel verlassen zu haben. Deshalb geht es im Laufschritt heimwärts, vorbei an frustrierten Frührentnern, die sich im „Park der kleinen Geister“ ihre schwarzen Seelen aus dem Leib saufen, vorbei an geistigem Lumpenproletariat, an tauben Nüssen, von denen der eine nur arrogant bis böse vor sich hin stiert und der andere das Publikum beschimpft. Mutter Piepgas atmet auf, als die Haustür hinter ihr ins Schloss fällt. Vom Hunger getrieben, eilt sie in den Hof hinaus. Dort bestreicht sie die Bäume mit Leberwurst und beißt hinein. Wenn nur die vielen Fliegen nicht wären, die den Himmel verdunkelnden Schmeiß- und Sturzkampffliegen …
Kleines Philisterium
Gott ist ein Spießer, und er schuf die Menschen nach seinem Ebenbild. Kein Wunder, dass Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Denn es schickt sich nicht für Spießer, vom Baum der Erkenntnis und noch viel weniger von den Bäumen der Uneigennützigkeit und Nächstenliebe zu kosten. Das wusste auch Baldrian Nachschlag, der Erfinder der Gähnmaschine. Er lebte ein leises Leben, eines der Langeweile, in den Banden der Bürgerlichkeit, und er lebte es in Doppelkorn, einem Provinznest im Land der Philister. Eines Tages übte Baldrian Nachschlag eine neue Gähntechnik ein, um sie sich patentieren zu lassen. Da geschah es, dass die Gäule der Phantasie mit ihm durchgingen. Der Nachschlag stellte sich vor, wie er sich von der Last der Ketten, in die er geschlagen war, befreite. Er stand aus seinem Sessel, seiner Gähnmaschine auf und verließ ein Leben in trockenen Tüchern, er wischte alles weg, Haus und Hof, Frau und Kinder. Er ging, ohne einen Blick zurück, ohne die Türen, die er geöffnet hatte, zu schließen. Dann gähnte er von ganzem Herzen ... und furzte. Allzu oft sind ihm die Gäule seiner Phantasie schon durchgegangen, allzu oft hatte er sie wieder eingefangen.Baldrian Nachschlag schleppte einen Sack voll Sorgen mit sich herum. „Sorgen schwimmen immer oben auf“, sagte sich der Nachschlag und nickte ein. Seine größte Plage war sein Nachbar, Maler Popelberger, ein großer Einfaltspinsel, der ihm das Schwarze unter den Nägeln nicht gönnte. Der Nachschlag und der Popelberger hassten sich aus Langeweile, sie konnten sich nicht riechen, weil sie sonst nichts zu tun hatten. Sie wären einander gute Nachbarn gewesen, wenn ihr Leben einen Sinn gehabt hätte, wenn sie ihre überschüssige Zeit und Energie mit dem Sammeln und Sortieren von Briefmarken oder bei der Feuerwehr verschwendet hätten … und wenn sie sich und ihr abgestandenes Leben, ihre Feigheit und Hässlichkeit nicht hassen würden, denn Hass ist auf andere übertragener Selbsthass. Und so kam es zum Kampf zweier Nullen. Der Zufall in Gestalt eines Zeremonienmeisters wollte es, dass die beiden beim Schützenfest nebeneinander saßen. Plötzlich schrie der Popelberger: „Wo ist mein Zahnstocher? Niemand verlässt den Raum!“ So etwas ließ sich der Nachschlag nicht zweimal sagen. Er stand auf und ging. Der Popelberger ihm nach. Es ging um die Ehre, um die goldene Sklavenkette der bürgerlichen Gesellschaft. Auf der Festwiese, in einem Kreis von Claqueuren, von Applauspöbel, zog der eine ein verschmiertes Wurstmesser, der andere eine Sportpistole. Der eine schoss, der andere stach zu.



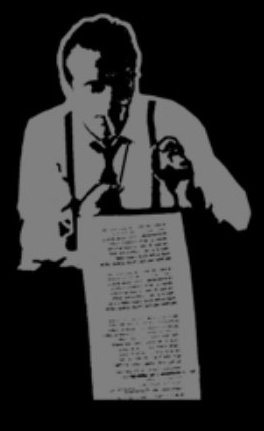


![Fuck (c) - und die Alternative [click] Fuck (c) - und die Alternative [click]](./templates/aponaut/img/fuck_c2.jpg)
